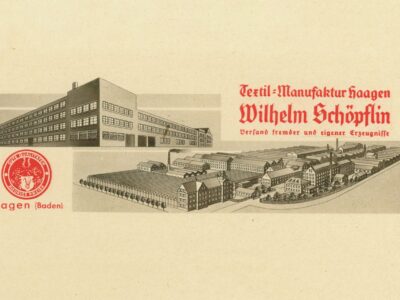Unsere Postings sind die Munition
Kein Kommentar ohne Kalkül: Soziale Medien haben uns alle zu Strateg:innen erzogen. Und trotzdem ist unsere Kommunikation politisch beliebig instrumentalisierbar.

Ein Gastbeitrag von Annekathrin Kohout
Erinnern Sie sich an die Szene im Film Jumanji, als die Würfel auf dem magischen Spielbrett fallen? In diesem Moment – das ahnt man – beginnt etwas, das sich nicht mehr aufhalten lässt. Jeder Spielzug zieht die Spielenden tiefer hinein, wird ihnen regelrecht zum Verhängnis. Diese Szene ist 30 Jahre alt, aber genauso fühlen sich Soziale Medien im Jahr 2025 an: wie ein riesiges Spiel, dem man, hat man einmal das Feld betreten, zwingend ausgesetzt ist. Jedes Posting, jeder Kommentar, jedes Schweigen wird zur Taktik. Die Regeln sind kaum zu durchschauen, die realen Konsequenzen aber beinahe täglich zu spüren.
Diese Dynamik habe ich in meinem Buch Hyperreaktiv. Wie in sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird analysiert: Was als demokratische Teilhabe verheißendes Online-Instrument begann, hat sich zu einer Kultur entwickelt, in der Feedback nicht mehr freiwillig, sondern obligatorisch geworden ist. Der französische Philosoph Jean Baudrillard hat die Massenmedien des 20. Jahrhunderts einmal als „Rede ohne Antwort“ problematisiert. Medien wie das Fernsehen, Radio oder Zeitungen waren linear, Zuschauende oder Lesende konsumierten zwar, interagierten aber nicht und konnten nur selten antworten. Mit der Konsequenz, dass sie zwar empört oder gerührt oder begeistert sein mochten, ihre Empfindungen aber „frei im Raum schwebend“ blieben, wie der Technikphilosoph Günther Anders es formulierte.
Zu diesem Konzept waren die Sozialen Medien der große Gegenentwurf: Endlich war Antwort möglich! Endlich konnte man reagieren, kommentieren, sich in Debatten einbringen, Kontrolle gewinnen und auch seinen Empfindungen Ausdruck verleihen – es war der Triumph der Partizipation. Nichts musste mehr in der Schwebe bleiben.
Doch dieser Befreiungsschlag, die Verwandlung des Publikums in Akteur:innen, gern auch Demokratisierung genannt, hat sich schnell ins Gegenteil verkehrt. Ich beschreibe die heutige Landschaft Sozialer Medien als „Antwort ohne Rede“: als eine Reaktionskultur, in der es kaum noch um die Inhalte selbst geht, sondern darum, wie viele und welche Reaktionen sie erhalten. Die ursprüngliche „Rede“ – ein Video, ein Text, ein Bild – schrumpft zum Auslöser, zur reinen Projektionsfläche. Oder wie Samira El Ouassil meine These in ihrer Kolumne in media res zusammengefasst hat: „Das Ereignis wird zur Fußnote seiner eigenen Rezeption.“
Und mehr noch: Reaktionen sind oft eine aggressivere und konfrontativere Kommunikationsform als eigenständige Äußerungen. Denn wer reagiert, kann sich auf etwas berufen – auf eine Provokation, eine Zumutung, einen Angriff. Die Reaktion erscheint dadurch als gerechtfertigt, ja geradezu geboten, selbst wenn sie härter ausfällt als der ursprüngliche Impuls. Das Reagieren legitimiert seine eigene Schärfe: Nicht ich bin aggressiv, sondern ich wurde dazu gezwungen. Außerdem steht jede Äußerung per se zur Diskussion, kann sofort von einer Armee von Interpret:innen in Beschlag genommen werden. In meinem Buch nenne ich solche instrumentellen und zerstörerischen Reaktionen „Hyperinterpretationen“. Diese Praxis wird in den Sozialen Medien kultiviert und zeigt sich in der obsessiven Spurensuche nach verborgenen Motiven in jeder Äußerung, jedem Video, jedem Bild. Die damit verbundene Radikalisierung des Verdachts ist alltäglich zu beobachten.
Die Plattformen erziehen uns User zu Strateg:innen, manchmal ohne dass wir es merken. Im Privaten kalkulieren wir, welche Urlaubsfotos das richtige Signal senden, welche Freundschaften sichtbar gemacht werden sollen, welche lieber „privat“ bleiben. Content Creator optimieren nicht nur ihre Postings für Reichweite, sondern auch ihre vermeintliche Authentizität – selbst die „ehrliche“ Verletzlichkeit wird zur kalkulierten Performance. Marken und Influencer betreiben ausgefeiltes Personal Branding, bei dem jede Kooperation, jede politische Äußerung, jedes Schweigen auf Markenwert und Zielgruppenansprache hin überprüft wird. Und im politischen Aktivismus wird jede Stellungnahme danach bewertet, ob sie korrekt positioniert ist, ob der Zeitpunkt stimmt, ob man damit auf der richtigen Seite steht – oder ob man sich besser heraushalten sollte, um nicht angreifbar zu werden. Sogar Solidarität ist zur strategischen Entscheidung geworden: Mit wem äußert man sich gemeinsam? Wessen Posts teilt man? Welche Hashtags verwendet man?
Das Strategische beginnt und endet nicht beim individuellen Kalkül. Auch (geo)politische Einflussnahmen durchdringen Soziale Medien. Schließlich sind diese Plattformen die technischen Umgebungen dessen, was wahlweise „Soft Power“, „Kulturkampf“ oder „Informationskrieg“ genannt wird. Wer durch die Feeds scrollt, landet zwischen Reisevideos aus Nordkorea, in denen westliche Influencer auf die „Freundlichkeit“ der Menschen hinweisen, Clips aus Shenzhen, die den chinesischen Fortschritt feiern, und Threads, in denen erklärt wird, dass deutsche Politik naiv, die westliche Presse verlogen und Demokratie ohnehin ein Luxusbegriff sei. Und die USA? Sie fluten die Zone mit Shit – was wiederum ausgiebig als Strategie der Aufmerksamkeitssteuerung diskutiert wird.
Ein ebenso beherrschendes Thema: Während rechte und autoritäre Kräfte Hyperinterpretationen oder reaktionstaugliche Memes erklärtermaßen als Mittel im Kulturkampf einsetzen, verirrt sich die politische Linke zwischen Ironieskepsis und heiligem Ernst. Die Rechten, so heißt es, hätten den Kulturkampf gewonnen, weil sie memen können – leicht, viral, ohne moralischen Ballast. Die Linke hingegen, die es angeblich gar nicht mehr gibt, stehe sich selbst im Weg: zu viel Kulturindustriekritik, zu viel Wokeness, zu viel Moral. Sie diskutiert lieber, wie man darauf strategisch reagieren könnte. Soll man zurückmemen? Soll man die Strategien offenlegen? Soll man sich dem Spiel verweigern? Jede dieser Optionen wird strategisch abgewogen, auf Panels und in Podcasts. Aber ist das wirklich der Punkt? Oder ist das selbst schon wieder ein strategisches Narrativ, das der eigentlichen Frage ausweicht: Wer profitiert davon, dass wir diese Debatten so führen?
Die Hyperreaktivität ist zur Selbstverstärkungsmaschine geworden. Jeder Klick, jede Empörung, jede gut gemeinte Klarstellung: Alles füttert den Algorithmus, alles kann zur Munition im Kampf um Narrative werden.
Ist das nicht wahnsinnig erschöpfend? Der Medienwissenschaftler Geert Lovink hat diese affektive Erschöpfung in seinem neuen Buch Platform Brutality anschaulich beschrieben: „Du bist tief drin. Wenn Kommentare durch deine Adern fließen, Videos dein Gehirn umkreisen und Symbole deine Nerven strangulieren, merkst du, dass deine Seele zerbrochen ist. Entfremdet von deinem aufgeblasenen Profil, tun alle Selfies weh […]. Es besteht das Bedürfnis, auf eine Weise Glück zu haben, die nicht mehr möglich ist.“ Dieser Zustand ist keine Randerscheinung, sondern bildet das emotionale Grundrauschen einer Kultur, die von strategischer Selbstwahrnehmung durchdrungen ist.
Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass es keinen einfachen Ausweg aus diesem Zustand gibt. Zumindest keinen, der nicht selbst zum strategischen Zug wird. Das aber ist keine Rechtfertigung der Resignation. Es ist die Anerkennung einer Realität, in der strategisches Denken so tief in unsere Kommunikation eingeschrieben ist, dass selbst die Analyse dieser Mechanismen zum Spielzug wird. Dieser Text eingeschlossen.
Das Buch „Hyperreaktiv: Wie in Sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft wird“ von Annekathrin Kohout ist im Wagenbach Verlag erschienen. Am 23. Oktober hat sie es bei Publix vorgestellt.